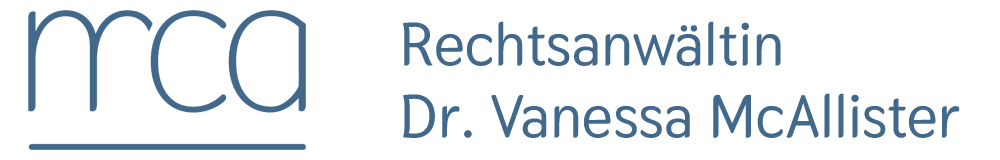Wie medial berichtet hat der Oberste Gerichtshof die im ersten Rechtsgang gegen Rewe verhängte Kartellgeldbuße von € 1,5 Mio auf € 70 Mio angehoben (OGH 16 Ok 5/24g). Mit dieser Geldbußhöhe wird ein neuer österreichischer Rekord aufgestellt, und das, obwohl sich das verpönte Verhalten gar nicht gegen das Kartellverbot gerichtet hat. Vielmehr wird Rewe vorgeworfen, im Jahr 2018 in Wels Supermarktflächen übernommen zu haben, ohne dies rechtzeitig bei der Bundeswettbewerbsbehörde zu melden. Die Entscheidung des OGH ist aus kartellstrafrechtlicher Sicht in vielerlei Hinsicht interessant und lehrreich:
- Durchführungsverbot: kein Kavaliersdelikt
Zunächst betont der OGH, dass die unterlassene Anmeldung eines Zusammenschlusses und der damit einhergehende Verstoß gegen das Durchführungsverbot in § 17 Kartellgesetz kein Kavaliersdelikt darstellt. Zwar sei ein solcher Verstoß im Ergebnis milder zu beurteilen, wenn mangels eines Untersagungstatbestandes ein „untersagungsfernes“ Zuwiderhandlung gegen eine bloße Formvorschrift vorliegt; ein Absehen von der Verhängung einer Geldbuße wegen geringen Verschuldens in analoger Anwendung des § 191 StPO – wie dies das Kartellgericht noch im ersten Rechtsgang befürwortet hatte – hat der OGH aber bereits in einer vorangegangenen Entscheidung in dieser Angelegenheit abgelehnt (OGH 16 Ok 4/23h). Auch in dieser vorangegangenen Entscheidung hat der OGH betont, dass mit der Verhängung einer „quasi symbolischen Geldbuße“ nicht das Auslangen gefunden werden könne, weil die Geldbuße eine solche Höhe erreichen müsse, dass sie spürbar ist und zum Ausdruck bringt, dass eben kein Kavaliersdelikt vorliegt.
Dennoch ist hervorzuheben, dass der OGH die grundsätzliche Anwendbarkeit des strafprozessualen Absehens von der Verfolgung nach § 191 StPO bejaht hat, womit er abermals eine Norm des gerichtlichen (Kriminal-)Strafrechts im kartellgerichtlichen Geldbußeverfahren – das systematisch nicht dem Strafrecht zugeordnet ist – herangezogen hat. In derselben Entscheidung hat der OGH ebenso bestätigt, dass das Vorliegen von „Verschulden“ (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) nach § 3 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG), also ebenfalls einer (kriminal-)strafrechtlichen Norm, zu prüfen ist. Schließlich bestätigt der OGH ein weiteres Mal, dass das kartellgesetzliche Geldbußeverfahren eine „strafrechtliche Anklage“ („criminal charge“) im Sinn des Art. 6 EMRK ist.
- Kriterien der Strafzumessung
Während das Kartell(straf)recht kaum inhaltliche Regelungen vorsieht, unter welchen Voraussetzungen eine Kartellgeldbuße verhängt werden kann (z.B. wann liegt ein „Verschulden“ vor, ist ein „Verbotsirrtum“ relevant), wird die Bemessung der Geldbuße näher in § 30 Kartellgesetz geregelt. Demnach ist bei der Strafzumessung insbesondere auf die Schwere und die Dauer der Rechtsverletzung, auf die dadurch erzielte Bereicherung, auf den Grad des Verschuldens und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen. Darüber hinaus zählt das Gesetz exemplarisch Erschwerungs- und Milderungsgründe auf.
Dass diese Vorschrift zur Geldbußenbemessung dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot (Art. 18 B-VG und Art. 7 EMRK) nicht genügen würde, verneint der Oberste Gerichtshof. Wenn man bedenkt, dass sonstige Grundsätze der Strafbarkeit gänzlich fehlen, erscheint § 30 Kartellgesetz tatsächlich hinreichend detailliert. Die Regelung orientiert sich dabei an die strafrechtlichen Vorgaben in §§ 32 ff Strafgesetzbuch (StGB) und legt ausreichend fest, wie die konkrete Höhe der Geldbuße zu bemessen ist. Problematisch erscheint vielmehr, dass sich die Geldstrafe für die einzelnen Geldbußetatbestände (§ 29 Abs. 1 KartG) ausschließlich am Umsatz orientiert und, abgesehen von der 10 %-Höchstbetragsgrenze, nicht weiter determiniert ist. Damit legt das Gesetz nicht nur den Fokus auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die nach § 30 Kartellgesetz eigentlich nur einen von mehreren Zumessungsfaktoren darstellt, sondern räumt dem Gericht auch einen außerordentlich weiten Zumessungsspielraum ein; im Anlassfall lag dieser zwischen € 0 und € 9,23 Milliarden.
Was würde der OGH zum Strafrahmen „Freiheitsstrafe von 1 Monat bis zu 40 Jahre“ für ein Delikt im Kernstrafrecht sagen?
- Anknüpfung am weltweiten Konzernumsatz
Bei einem solchen Verstoß ist eine Geldbuße bis zu einem Höchstbetrag von 10 % des „im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes“ zu verhängen. „Gesamtumsatz“ meint dabei den Umsatz aller Unternehmen, die im Sinn des Kartellgesetzes miteinander verbunden sind, d.h. im Wesentlichen den weltweiten Konzernumsatz. Die Frage des für die Berechnung der Geldstraße maßgeblichen Umsatzes ist daher von der Frage der Täterschaft zu trennen. Dies führt im Regelfall zu einer gänzlich anderen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, als wenn bloß auf den Umsatz des konkret zuwiderhandelnden Unternehmens abgestellt werden würde; aus (zutreffender) Sicht des OGH begründet das aber keinen Verstoß gegen das Prinzip nulla poena sine culpa. Immerhin wird die solcherart bemessene Geldstrafe dennoch „nur“ gegen das Täterunternehmen verhängt, das nach den gerichtlichen Feststellungen fahrlässig gehandelt hat. Fraglich ist eher, ob diese Art der Bemessung dem Kriterium der „wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“ gerecht wird.
Zudem wird hier eine zuletzt erfolgte Änderung der Rechtsprechung zur Frage, welcher Jahresumsatz der maßgebliche ist, schlagend: Während nach früherer OGH-Ansicht das letzte Geschäftsjahr der Zuwiderhandlung heranzuziehen war, ist nun jener Gesamtumsatz maßgeblich, der im Geschäftsjahr vor der erstinstanzlichen Entscheidung erzielt wurde. Damit wird – nicht zwingend, aber oftmals – ein Umsatz zur Bemessung herangezogen, der in Wahrheit viele Jahre nach der Zuwiderhandlung erzielt wurde. Wenn der OGH daher bei der Strafzumessung behauptet, „die im Gesetz festgelegten Grundsätze und Bemessungsfaktoren erlauben es dem Normunterworfenen, die Höhe der festzusetzenden Geldbuße innerhalb des vorgegebenen Rahmens hinreichend genau vorherzusehen“, sei doch die Frage erlaubt, wie der Normunterworfene im Zeitpunkt der Zuwiderhandlung (auch nur annähernd) den später im Geldbußeverfahren angewendeten Strafrahmen – nämlich den zukünftig erwirtschafteten weltweiten Konzernumsatz – vorhersehen soll.
Letztlich zeigt diese Entscheidung besonders plakativ, dass das Kartellrecht, insbesondere das Kartellgeldbußenrecht – obwohl, oder sogar: weil es in Wahrheit Strafrecht ist – eine Vielzahl von Fragen aufwirft, die im Gesetz gar nicht oder nur unbefriedigend beantwortet werden. Die Festlegung von Strafrahmen, die nicht nach dem jeweiligen Verstoß unterscheiden, sondern sich einzig an einem weltweiten Konzernumsatz orientieren, erscheint einmal mehr verfehlt.
Eine Ausrichtung des Kartellstrafrechts an strafrechtlichen Grundsätzen wäre meines Erachtens längst angezeigt.
Zum weiteren Nachlesen: die Stellungnahme von Rewe und ein lesenswerter Medienbericht vom Der Standard.